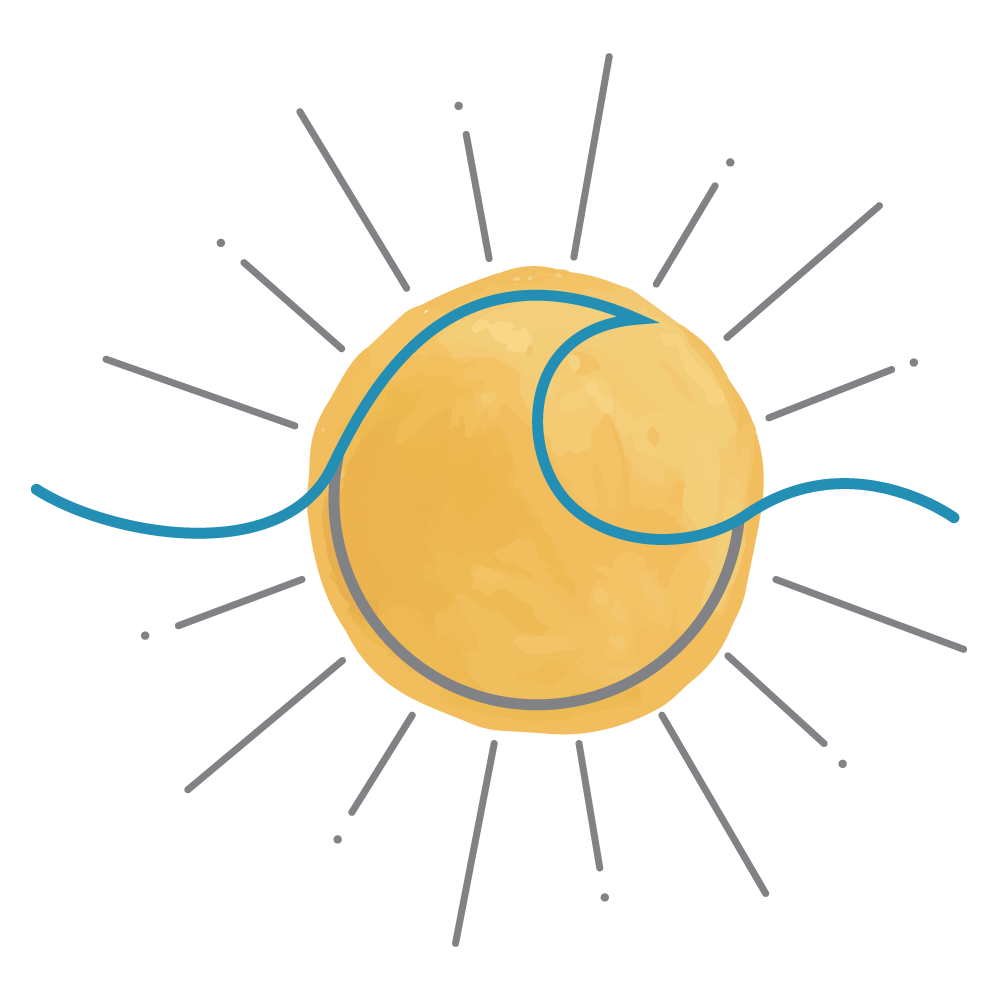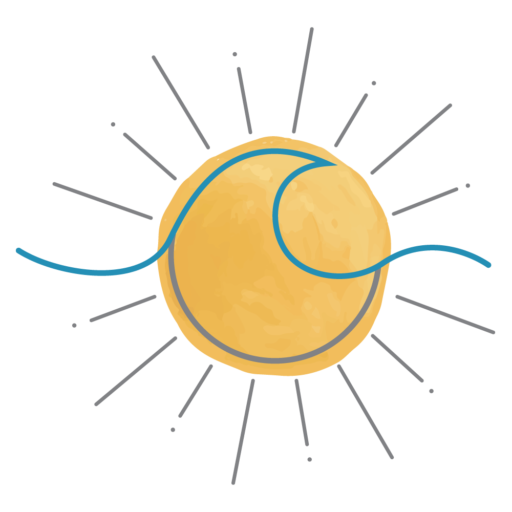“Wurde ich bei einem Ritual gestört, überkam mich Ohnmacht”
In meiner Kolumne „Talking Minds“ erzählen Menschen von ihrer psychischen Erkrankung. Diesmal: Wie Isabelle ihren Waschzwang in den Griff bekam.
In Folge zwei von “Talking Minds” geht es um eine Zwangserkrankung, davon erzählt Isabelle. Die 35-Jährige arbeitet im Onlinehandel und studiert Germanistik. Im Jahr 2011 wurde bei ihr ein Waschzwang diagnostiziert.
Am Ende des Textes findest du generelle Informationen zu dem Thema Zwangserkrankungen.
Veröffentlicht bei jetzt, dem Onlinemagazin der Süddeutschen Zeitung
„Vor ungefähr neun Jahren fing meine Zwangserkrankung an. Wenn ich damals von meiner Arbeit als Physiotherapeutin nach Hause kam, wischte ich im Auto erstmal alles ab, was ich angefasst hatte, manchmal dreimal hintereinander. Im Haus dasselbe: Türklinke, Lichtschalter, Schlüssel, Handy. Alle Gegenstände, die von draußen in die Wohnung kamen, wie zum Beispiel meine Arbeitssachen, bewahrte ich direkt hinter der Haustür auf. Dann zog ich mich komplett um und achtete penibel darauf, dass ich dabei nichts in meiner Wohnung berührte. Ich wusch mir meine Hände mindestens fünfmal, bis ich mir sicher war, dass sie auch sauber waren und desinfiziert sie. Daraufhin duschte ich. Erst danach zog ich die Klamotten an, mit denen ich mich in der ganzen Wohnung bewegen konnte. Dieses Ritual hat eine halbe Stunde gedauert.
“Wurde ich während meines Rituals gestört, überrollte mich Ohnmacht.”
Die meisten Leute mit Waschzwang haben Angst, krank zu werden. Ich hatte eher Angst, dass ich fremde Bakterien und damit fremde Menschen in meinen privaten Bereich lasse. Ich unterteilte die Welt in Drinnen und Draußen: Keine Bedrohung und Gefahr durfte von außen in meine geschützte Sphäre gelangen. Durch mein Wasch- und Reinigungsritual hatte ich das Gefühl, die anderen aussperren zu können – und damit auch meine Angst. Wurde ich während meines Rituals gestört, überrollte mich Ohnmacht und es fühlte sich an, als würde ich in ein schwarzes Loch gesogen. Ich fühlte mich körperlich unglaublich unwohl und mutterseelenallein, konnte mich nicht bewegen. Um ein Gefühl von Kontrolle zurückzubekommen, musste ich dann das Ritual von vorne beginnen.
“Man kann sich das vorstellen, wie eine unendlich lange To-Do-Liste, die man eigentlich nie abarbeiten kann”
Ich schämte mich für meine Zwangserkrankung und hatte Angst, damit aufzufallen. Zum Beispiel, wenn ich mit Freunden unterwegs war und nicht die Möglichkeit hatte, direkt meine Hände zu waschen. Nachdem ich mit der rechten Hand etwas Verunreinigtes angefasst hatte, ballte ich sie so lange zur Faust und machte alles mit der linken Hand, bis ich mich waschen konnte. Weil ich Rechtshänderin bin, sah das natürlich komisch aus und ich hatte Angst, meine Freunde könnten das bemerken. Außerdem stand ich unter extremer Anspannung. Ich überlegte die ganze Zeit, was ich alles angefasst hatte und was ich deshalb alles tun müsste. Diese Gedanken spann ich immer weiter, bis nichts anderes mehr in meinem Kopf Platz hatte. Das war unfassbar anstrengend. Man kann sich das vorstellen, wie eine unendlich lange To-Do-Liste, die man eigentlich nie abarbeiten kann.
“Für Menschen mit Zwangserkrankung ist es die schwerste Sache von allen, Kontrolle abzugeben.”
Ich kann nicht genau sagen, wie meine Zwänge anfingen. Sie schlichen sich allmählich in mein Verhalten ein. Mein damaliger Freund sagte mir immer wieder, dass ich eine Krankheit habe. Aber ich dachte, ich bekäme das Problem allein in den Griff und war zu stolz, um von außen Hilfe anzunehmen. Das hätte außerdem bedeutet, Kontrolle abzugeben – für Menschen mit Zwangserkrankung ist das die schwerste Sache von allen.
Ein Ereignis brachte mich zum Umdenken: Eines Tages stand ich während meines Reinigungsrituals mitten in meinem Wohnzimmer und fühlte mich plötzlich wie dement. Ich wusste gar nicht mehr, was ich gerade noch machen wollte. Ich wusste nichts mehr, alles war zu viel! In dem Moment wurde mir klar, dass ich allein nicht weiterkommen würde. Ich habe mich dann einer Freundin anvertraut und sie suchte mit mir einen Therapeuten raus. Der Schritt, anzurufen und mir damit einzugestehen, dass ich Hilfe brauche, war unglaublich herausfordernd. Die Diagnose selbst war dann nur eine Bestätigung.
“Die Expositionstherapie half mir am meisten.”
Die erste Therapie wühlte bei mir einiges auf. Nach vier Wochen hatte ich ein Burn-out und konnte nicht mehr arbeiten. Ich ging dann in eine psychosomatische Rehaklinik, die mir sehr weitergeholfen hat. Auch weil ich dort Leidensgenossen traf. Nach der Reha bekam ich einen Platz in der Zwangsambulanz in Berlin. Die Expositionstherapie, die in der Verhaltenstherapie bei der Behandlung von Zwängen ein wesentlicher Bestandteil ist, half mir am meisten.
Man begibt sich dabei in Situationen, die besonders angsterfüllend sind. Meine Therapeutin kam unter anderem zu mir nach Hause und wir legten zum Beispiel meinen Schlüssel oder Geldbeutel auf mein Bett. Das war unglaublich herausfordernd, denn das sind Dinge, die draußen auch mal auf den Boden fallen können. Aber ich musste diese Angst aushalten und beschreiben, wie es mir dabei ging. Immer wieder. Mit der Zeit wurde die Angst weniger und irgendwann war sie weg.
“Andere sollten bei den Zwangshandlungen nicht mitmachen, sondern sich möglichst normal verhalten.”
Meine Familie verstand meine Erkrankung zuerst nicht oder wollte sie nicht wahrhaben, weil sie ihnen peinlich war. Mein Vater sagte zum Beispiel: ‚Hör doch einfach auf, deine Hände zu waschen.‘ Er verstand nicht, dass ich das gerne lassen würde, aber nicht konnte. Viele Freunde reagierten rücksichtsvoll und mein damaliger Freund versuchte sogar, mich bei meinem Reinigungsritual zu unterstützen. Aber das ist beides falsch. Andere sollten bei den Zwangshandlungen nicht mitmachen, sondern sich möglichst normal verhalten. Nachdem es mir schon besser ging, hatte ich einen Rückfall, als jemand aus meinem Umfeld gestorben ist. Mir war das sehr peinlich, als meine Eltern gesehen haben, dass mein Zwang wieder stärker war. Für mich war es am schlimmsten, wenn jemand, der mir nahestand, sehen musste, dass es mir wieder schlechter ging und ich noch nicht stark genug war, das ständige Waschen einfach sein zu lassen.
“Mir hat es geholfen, mich über die Krankheit zu informieren”
Unverständnis hatte ich vorher übrigens auch in meinem Job erlebt: Als Physiotherapeutin war mein Zwang besonders problematisch, da ich viele Leute anfassen musste und ich mir deshalb besonders oft die Hände gewaschen habe. Ich habe meinen Kollegen deshalb einmal einen Brief geschrieben, in welchem ich versucht habe, meinen Zwang zu erklären. Abgesehen von einem Kollegen hat keiner darauf reagiert. Das Desinteresse der anderen hat mich tief enttäuscht. Nach meinem Burn-out war ich eineinhalb Jahre krankgeschrieben und wurde als Physiotherapeutin für berufsunfähig erklärt. Ich suchte mir danach einen neuen Job und entschied mich für ein Studium.
Heute bin ich froh, wie sich alles entwickelt hat. Früher hat die Krankheit auch mein soziales Leben belastet und eingeschränkt: Wenn Freunde in eine Disco oder auf ein Konzert wollten, überlegte ich mir das zweimal und sagte manchmal ab. Fremde Toiletten, Menschen auf engem Raum, schmutzige Gläser – das hat mich zu sehr geekelt. Heute denke ich über diese Dinge kaum mehr nach.
Mir hat es geholfen, mich über die Krankheit zu informieren und mich einer Freundin anzuvertrauen. Als es mir schon besser ging, half es mir, vielen Leuten von meinem Zwang zu erzählen: Kommilitonen, meinen neuen Kollegen und einer Chefin. Sie haben alle positiv reagiert. Dadurch, dass ich das immer wieder wiederholt habe, habe ich mir die Krankheit eingestanden und die Scham hat abgenommen. Danach war der Zwang immer weniger ein Thema.
“Der Zwang und die Auseinandersetzung mit ihm haben mir gezeigt, wie wichtig es ist, die kleinen Dinge im Leben wertzuschätzen”
Ich habe die Zwangserkrankung offiziell nicht mehr. Aber ich glaube, dass ich mir immer mehr die Hände waschen und darüber nachdenken werde als andere Menschen. Das Zwangsverhalten automatisiert sich außerdem mit der Zeit. Wenn ich von draußen reinkomme, wasche ich mir zum Beispiel immer die Hände, auch wenn ich nur auf dem Balkon war.
Der Beginn der Corona-Pandemie hat meinen Zwang nochmal getriggert. Für eine Zeit schien es so, als würden sich alle meine Ängste von früher bewahrheiten. Mittlerweile ist es wieder besser geworden. Vor meinem Burnout habe ich in der Therapie beschrieben, dass ich gefühlt zu fünfundneunzig Prozent der Zeit unter meinem Zwang leide. Heute würde ich an richtig guten Tagen sagen, dass es nur noch fünf Prozent sind. Damit kann ich gut leben. Der Zwang und die Auseinandersetzung mit ihm haben mir gezeigt, wie wichtig es ist, die kleinen Dinge im Leben wertzuschätzen, wie zum Beispiel ohne Angst und Ekel barfuß laufen oder im Meer schwimmen zu können.
Infos zu dem Thema Zwangserkrankungen
Eine Zwangserkrankung ist durch Zwangsgedanken und/oder Zwangshandlungen (auch Zwangsrituale genannt) charakterisiert. Zwangsgedanken sind wiederkehrende, anhaltende, unerwünschte und aufdringliche Gedanken, Triebe oder Bilder, die Angst auslösen. Zwangshandlungen sind sich wiederholende Verhaltensweisen, die dazu dienen sollen, die Angst zu reduzieren oder zu verhindern. Obwohl sie von den Betroffenen als sinnlos oder ineffektiv wahrgenommen werden, müssen sie diese durchführen. Denn das Zurückhalten der Zwangshandlung führt in der Regel zu einem Anstieg von innerer Anspannung, Ängstlichkeit oder Unruhe, die erst nachlassen, wenn das Ritual durchgeführt wurde.
Laut DSM–5 wird eine Zwangsstörung diagnostiziert, wenn die Zwänge den Alltag stark beeinträchtigen und Leid verursachen. Erfolgreiche Behandlungsmethoden sind Psychotherapie und Pharmakotherapie. Die Therapieprognose für junge Menschen, die schnell Hilfe aufsuchen ist günstig. Besonders wirksam ist die Verhaltenstherapie.
Ungefähr ein bis zwei Prozent der Bevölkerung sind von Zwangsstörungen betroffen, Frauen etwas häufiger als Männer. Durchschnittlich tritt die Krankheit im Alter von 19 bis 20 Jahren erstmalig auf.