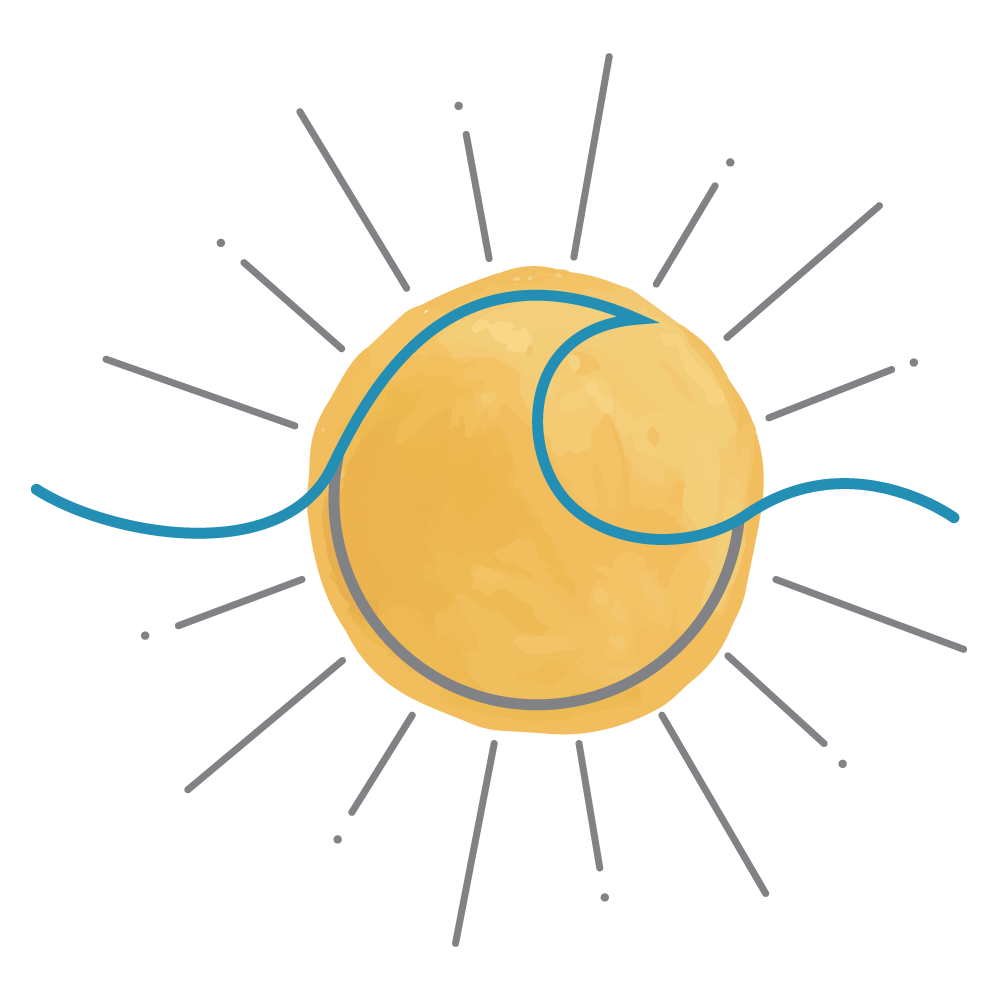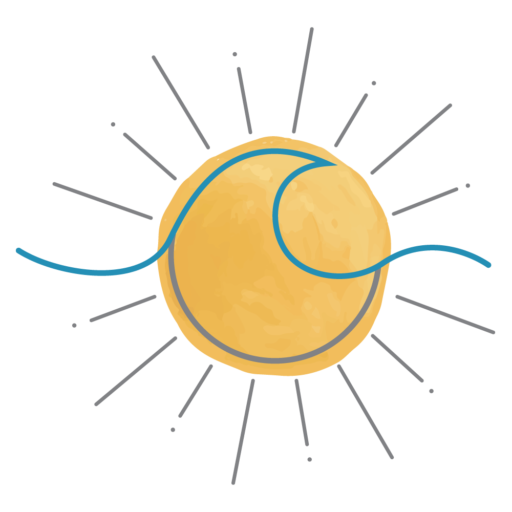„Auf der Arbeit darf niemand von meiner Erkrankung erfahren“
Millionen Deutsche sind psychisch krank – doch die wenigstens erzählen im Job davon. Zwei Betroffene und eine Psychologin sprechen über die Angst, als nicht funktionstüchtig gesehen zu werden.
Veröffentlicht bei jetzt, dem Onlinemagazin der Süddeutschen Zeitung
„Verliere ich jetzt meinen Job?“ Das war Alinas erste Angst, als sie in die psychiatrische Akutklinik kam. Alina hat grün-blaue Augen und schulterlange blonde Haare. Sie sitzt in ihrem Wohnzimmersessel, manchmal streift ihre Katze durch das Bild, als sie über Zoom mit fester Stimme erzählt. „Ich war zu diesem Zeitpunkt noch sicher: Auf der Arbeit darf niemand von meiner Erkrankung erfahren. Denn wer will schon jemanden, der psychisch nicht belastbar ist? Da brauche ich doch nur einen Fehler machen und dann zeigen die mit dem Finger auf mich!“ Also verheimlichte Alina, dass sie seit Jahren unter Depressionen leidet: Sie erfand Ausreden dafür, warum sie mittwochs regelmäßig früher gehen musste, warum sie immer wieder Arzttermine hatte. Die 30-Jährige sagte auch dann nichts, als die Erkrankung während der Pandemie schlimmer wurde, sie sich zunehmend zurückzog, kaum mehr aß – und schließlich zusammenbrach. Das Geheimhalten kostete sie Kraft: „Es ist so anstrengend, dieses Lügenkonstrukt aufrecht zu erhalten“, sagt sie, nun mit zitternder Stimme.
„Es ist so anstrengend, dieses Lügenkonstrukt aufrecht zu erhalten“,
Das weiß auch Psychologin Catharina Raubal von den beruflichen Trainingszentren der bfz, die Menschen mit psychischen Vorerkrankungen auf ihrem Weg zurück ins Berufsleben berät. Sie sagt im Gespräch mit jetzt: „Es kostet Energie, nicht offen zu sein.“ Um diese Last nicht dauerhaft allein tragen zu müssen, arbeitet sie mit ihren Klient:innen darauf hin, dass sie sich zumindest gegenüber Vertrauenspersonen öffnen können. „Das kann entlasten, sodass kein Bedarf besteht, die Erkrankung im professionellen Umfeld kundzutun. Andererseits kann das aber auf natürliche Weise dazu führen, dass Betroffene auch im Beruf zu ihrer Erkrankung stehen wollen.“
Sara ist Ärztin in Österreich und empfindet diesen Drang nicht. Bei dem Treffen mit jetzt trägt sie T- Shirt und sportliche Sneaker, ihre braunen Haare hat sie zu einem Pferdeschwanz gebunden. Seit vier Jahren ist Sara wegen Magersucht in psychotherapeutischer Behandlung – auf eigene Kosten. Denn wollte sie, dass ihre Behandlung durch die österreichische Krankenkasse finanziert wird, müsste ihre Therapeutin dort einen Antrag stellen, woraufhin ihre Diagnose in der österreichischen Krankenakte vermerkt würde. Diese ist allerdings für österreichische Ärzt:innen und damit für ihre Kolleg:innen und Vorgesetzte einsehbar. Sara will vermeiden, dass sie dadurch von ihrer Vorerkrankung erfahren könnten. „Ich habe einfach Sorge, dass meine Kolleg:innen mich für inkompetent oder weniger belastbar halten könnten. Dass meine Entscheidungen deswegen in Frage gestellt werden oder meine Meinung weniger ernst genommen wird.“
Psychische Erkrankungen gelten heute als die zweithäufigste Ursache für Ausfälle in der Arbeit.
Alina und Sara, die beide in diesem Text nicht mit ihren richtigen Namen genannt werden möchten, sind nicht allein mit ihren Sorgen und Fragen in Hinblick auf den Umgang mit ihrer Erkrankung am Arbeitsplatz. Allein in Deutschland leiden etwa 18 Millionen Menschen jedes Jahr unter psychischen Problemen. Das wirkt sich zunehmend auf die Arbeit aus: Laut dem Psychoreport der DAK- Gesundheit aus dem Jahr 2020 stieg die Anzahl von Fehltagen, die durch psychische Erkrankungen begründet sind, von 2000 bis 2019 um 137 Prozent. Psychische Erkrankungen gelten heute als die zweithäufigste Ursache für Ausfälle in der Arbeit. Dabei machen gar nicht alle ihr Leiden transparent, sondern machen in der Arbeit weiter, wie bisher. Viele Betroffene quälen dieselben Fragen: Was, wenn meine Erkrankung in der Arbeit bekannt würde? Muss oder sollte ich meinem Arbeitgeber davon erzählen? Längst nicht alle entscheiden sich dafür.
Lange war für Alina klar: Offenheit über ihre psychische Erkrankung könnte Schaden anrichten.
Tatsächlich würde Psychologin Raubal nicht allen Erkrankten raten, sich am Arbeitsplatz als psychisch krank zu outen. „Empfehlungen für ein Outing geben wir dann, wenn wir die Erkrankung als so sichtbar einschätzen, dass ein Arbeitgeber spätestens beim Vorstellungsgespräch fragen wird: Was ist mit diesem Menschen los?“, sagt Raubal. Oder, wenn die betroffene Person den Drang dazu hat. Die Entscheidung müsse individuell getroffen werden: Ob ein Outing sinnvoll oder gewünscht wird, hänge von Faktoren wie Selbstvertrauen, Selbstbild, Persönlichkeit des Betroffenen sowie der Atmosphäre am Arbeitsplatz ab. Die zentrale Frage der Beratung sei, was es einen Menschen koste, in seinem Arbeitsverhältnis nichts von der Erkrankung zu erzählen. „Was macht es mit mir, wenn ich das erzählen kann? Was macht es mit mir, wenn ich das nicht kann?“ Diese Fragen müsse jede:r für sich beantworten, sagt die Psychologin.
Lange war die Antwort für Alina klar: Offenheit über ihre psychische Erkrankung könnte Schaden anrichten. Denn als sie zwei Jahre vor ihrem Zusammenbruch nahestehenden Menschen von ihren psychischen Problemen erzählt hatte, warfen ihr manche vor, sie würde übertreiben oder nach Aufmerksamkeit suchen – eine schmerzhafte Erfahrung. Die sollte sich im Job nicht wiederholen. Erst in der Klinik traf sie dann auf Menschen, die Ähnliches erlebt hatten, die sie verstanden. „In dieser Zeit habe ich entschieden, dass die Erkrankung ein Teil von mir ist“, erzählt Alina. Sie habe gesehen, dass es viele mit ähnlichen Problemen gibt – und sich dann gefragt: „Wer kann mir aus einer Erkrankung einen Strick drehen? Und möchte ich für jemanden arbeiten, der mir da einen Strick draus dreht?“ So habe sie die Entscheidung getroffen, dass sie nicht mehr lügen wollte. Sie begann, über ein Outing am Arbeitsplatz nachzudenken.
Im Rollenspiel kann man erproben, wie man sein Anliegen gut rüberbringen kann.
„Eine psychische Erkrankung am Arbeitsplatz anzusprechen, erfordert Mut – denn oft steht dabei viel auf dem Spiel“, sagt Psychologin Raubal. Sie rät deshalb dazu, vorher im privaten Umfeld oder mit professioneller Unterstützung zu üben und sich eine Meinung einzuholen. „Im Rollenspiel kann man erproben, wie man sein Anliegen gut rüberbringen kann, ohne einen Seelenstriptease hinzulegen“, sagt sie. Auch das persönliche Ziel des Outings sollte dabei mitbedacht werden: Was will man damit erreichen? Denn es kann einen Unterschied machen, ob man durch das Outing etwa Anspruch auf Extraleistungen kundtun oder mehr Verständnis erreichen möchte.
Für Sara, die Ärztin aus Österreich, hätte ein Outing vor allem einen Vorteil: Sie hofft, dass psychische Erkrankungen eines Tages nicht mehr mit Scham und Vorurteilen belastet sind und sich alle Betroffenen Hilfe suchen können. „Denn professionelle psychologische Hilfe kann darin unterstützen, Belastungen im Job standzuhalten und die eigene Arbeit gut zu machen“, sagt sie.
Ich muss mir jetzt keine Sorgen mehr machen was passiert, wenn jemand von meiner Erkrankung erfährt
Kurz vor ihrer Wiedereingliederung entschied Alina sich, ihrer Chefin den Grund für ihre lange Abwesenheit anzuvertrauen. Den konnte die Chefin der Krankschreibung aus der psychosomatischen Klinik zwar ohnehin erahnen. Trotzdem war Alina nervös: Wie würde ihre Chefin reagieren? Würde sie es schaffen, ihr Anliegen gut rüberzubringen? Nach dem Gespräch unter vier Augen war Alina erleichtert: Ihre Chefin hatte sich über die Offenheit gefreut.
Daraufhin fasste Alina den Entschluss, auch vor ihrem Team den Grund ihrer Abwesenheit anzusprechen. „Ich wollte anderen Betroffenen in der Firma dadurch zeigen, dass sie nicht allein sind und eine Ansprechpartnerin haben“, sagt Alina. Sie erzählte ihnen in einem Teammeeting, dass sie wegen einer schweren Depression in der Klinik war. Dass sie Zwänge und Zwangsgedanken hat, die sie dank der Medikamente unter Kontrolle hat. Und, dass sie sich zu lange nicht um ihre psychischen Probleme gekümmert hatte – eine Warnung an die Anderen: „Holt euch rechtzeitig Hilfe!“.
Ihr war es wichtig, ihr Anliegen mit professioneller Distanz rüberzubringen, ohne zu viel ins Detail zu gehen. „Bitte fasst mich nicht mit Samthandschuhen an“, sagte sie noch. Auch die Kolleg:innen reagierten wertschätzend. „Es kam nicht ein blöder Kommentar. Die Leute waren überrascht, aber sie haben versucht es sich nicht anmerken zu lassen und viele haben ihre Unterstützung angeboten“, erzählt Alina im Zoom-Call. In diesem Moment sei ihr eine wahnsinnige Last von den Schultern gefallen. „Es macht alles einfacher. Ich muss mir jetzt keine Sorgen mehr machen was passiert, wenn jemand von meiner Erkrankung erfährt. Und das ist wahnsinnig befreiend,“ sagt Alina.
Zu sagen ‚Ich bin oder war psychisch krank‘ gilt bei manchen Arbeitgebern noch als Schwäche“
Was Alina sich traute, möchten die meisten Klient:innen von Psychologin Raubal nicht nachmachen. Mit gutem Grund, sagt Raubal. Ein Outing könne schließlich auch anders ausgehen: „Wir haben eine Arbeitswelt, die teilweise sehr leistungsorientiert denkt. Zu sagen ‚Ich bin oder war psychisch krank‘ gilt bei manchen Arbeitgebern noch als Schwäche“, sagt Raubal. Es gäbe einfach sehr verschiedene Führungskräfte: Manche danken für die Offenheit. Das sei besonders oft der Fall, wenn schon ein persönliches Vertrauensverhältnis besteht. Andere stellen Menschen mit Vorerkrankungen gar nicht erst ein – oder kündigen sie bei kleinen Fehlern noch in der Probezeit. Einen entscheidenden Vorteil habe das Outing aber immer: „Dass Arbeitgeber und -nehmer dann über passende Bedingungen sprechen können, durch die ein langfristiges Beschäftigungsverhältnis möglich ist.“
Außerdem gibt es Hilfe für diejenigen, die sich vor der Reaktion ihrer Vorgesetzten sorgen: Je nach Firmengröße und Unternehmenskultur gäbe es verschiedene Anlaufstellen, an die man sich in diesem Fall wenden könne, sagt Raubal. Oft seien das Betriebsärzt:innen, Schwerbehindertenbeauftragte oder Personalbeauftragte mit Sonderaufträgen, wie zum Beispiel BEM- Beauftragte. Raubal rät aber, eines sicherzustellen: „Die Gesprächspartner müssen unter Schweigepflicht stehen, das sollte man sich bei Bedarf auch schriftlich bestätigen lassen.“
Einen entscheidenden Vorteil habe das Outing aber immer: „Dass Arbeitgeber und -nehmer dann über passende Bedingungen sprechen können, durch die ein langfristiges Beschäftigungsverhältnis möglich ist.“
Sich am Arbeitsplatz zu outen, ist eine persönliche Entscheidung, die von einer Reihe Faktoren abhängt. Viele Menschen möchten das Risiko eines Outings nicht eingehen, für andere ist es schlicht nicht notwendig. Leidet man unter dem Geheimhalten, solle man sich die Option anschauen, die Erkrankung anzusprechen, sagt Alina – denn sie ist längst kein Kündigungsurteil und das Mindset werde immer offener. So hat sie es schließlich auch selbst erlebt.
Sara aber bleibt dabei: Sie entscheidet sich noch immer gegen das Outing. „Für mich ist es ein Dilemma: Ich würde gerne dazu beitragen, dass psychische Erkrankungen weniger stigmatisiert werden. Sodass die Leute sich eher Hilfe suchen. Aber in meiner Arbeit davon zu erzählen? So weit möchte ich nicht gehen.“