“Sucht ist keine freie Wahl”
Suchterkrankungen gehören zu den psychischen Erkrankungen, die am meisten stigmatisiert werden. Was Vorurteile, Schuldzuweisungen und Diskriminierung mit Betroffenen macht.
Veröffentlicht am 11.07.2020 bei bento.de
Es war ein Sonntagmorgen vor neun Jahren, als Andreas* (32) sich eingestehen musste, dass er die Kontrolle verloren hatte. Dass er zu viel trank, war ihm damals schon länger klar. Trotzdem war es ihm lange Zeit gelungen, zumindest vor Anlässen wie dem Abitur oder der Führerscheinprüfung die Finger vom Alkohol zu lassen.
Als im Studium eine wichtige Zwischenprüfung anstand, wollte er es machen wie immer: zwei Wochen nichts trinken, Stoff reinpauken, Prüfung schreiben, weitertrinken. Am Tag vor der Prüfung wachte Andreas nach einem dreitägigen Rausch auf – und wurde von der Angst gepackt: Er konnte sich nichts mehr vormachen, er hatte seinen Alkoholkonsum nicht mehr im Griff. Er war süchtig.
Stundenlang irrte Andreas ziellos durch die Stadt. In einem Internetcafé googelte er die Anonymen Alkoholiker und besuchte noch am selben Abend sein erstes Treffen. In diesem geschützten Raum konnte er sich endlich öffnen und sah, dass er mit seinem Problem nicht alleine war. Andreas erinnert sich noch gut an diesen Abend. “Ich habe die meiste Zeit nur geheult. Das Gefühl, sich nicht mehr verstecken zu müssen, war einfach unglaublich”, sagt er.
“Wer süchtig ist, gilt als nicht belastbar, willensschwach und unzuverlässig. Wenn man einmal diesen Stempel hat, ist es eigentlich fast unmöglich, ihn loszubekommen”
Obwohl sein Vater ebenfalls Alkoholiker ist, wird das Thema Sucht in Andreas’ Familie totgeschwiegen. Bis heute hat er nur mit einem Teil seiner Familie über seine Suchterkrankung gesprochen, auch Freunden und Arbeitskollegen gegenüber ist er vorsichtig. “Ich bin insgesamt sehr sparsam mit Informationen nach außen, weil Sucht und Alkoholismus tabuisiert sind. Das ist eine schmutzige Ecke, da schaut man nicht gerne hin”, sagt Andreas. Unter seinen Kolleginnen und Kollegen in einer Behörde beobachtet er, wie hinter vorgehaltener Hand über Menschen mit Suchtproblematik geredet wird. Diese Lästereien möchte er sich ersparen. “Wer süchtig ist, gilt als nicht belastbar, willensschwach und unzuverlässig. Wenn man einmal diesen Stempel hat, ist es eigentlich fast unmöglich, ihn loszubekommen”, sagt Andreas.
Diese Angst teilen viele Menschen mit psychischen Erkrankungen: aufgrund ihrer Krankheit abgewertet, benachteiligt und ausgegrenzt zu werden. Denn psychische Erkrankungen sind häufig mit einem Stigma behaftet. “Stigmatisierung ist ein Prozess, der mit einer Normabweichung anfängt, das kann ein Merkmal oder die Diagnose einer psychischen Erkrankung sein”, erklärt Sven Speerforck, Oberarzt an der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Leipzig. “Mit dieser Normabweichung werden Vorurteile und Stereotype in Verbindung gebracht, die negative Emotionen auslösen – die wiederum zu Ablehnung und Diskriminierung führen.”
Vorurteile und Stereotype über Menschen mit Suchterkrankung halten sich hartnäckig
Substanzbezogene Abhängigkeitserkrankungen gehören zu den psychischen Erkrankungen, die am meisten stigmatisiert werden. Während das Wissen über psychische Erkrankungen in der Bevölkerung tendenziell ansteigt, halten sich viele Vorurteile und Stereotype über Menschen mit Suchterkrankungen hartnäckig. In einer repräsentativen Studie verglichen Forschende die Einstellung der Deutschen gegenüber Menschen mit Alkoholabhängigkeit in den Jahren 1990 und 2011. Sie stellten dabei fest, dass diese sich über die Jahre nicht veränderten hatten: Nur etwas mehr als die Hälfte der Befragten war der Meinung Alkoholabhängigkeit sei eine Krankheit wie andere auch, mehr als 40 Prozent hielten die Abhängigkeit für eine Charakterschwäche und 30 Prozent gaben den Betroffenen die Schuld dafür.
Eine andere Studie aus dem Jahr 2013 zeigt, dass viele Menschen sich von Suchtkranken distanzieren möchten: Mehr als 60 Prozent der Befragten lehnten es ab, eine imaginäre Person mit den Symptomen einer Alkoholerkrankung einem Freund vorzustellen, für einen Job vorzuschlagen oder ihr ein Zimmer zu vermieten. Gegenüber Abhängigen illegaler Drogen sind die Vorbehalte in der Regel noch größer (Psychiatrische Praxis ). Auch die Bereitschaft zur Solidarität ist in der Gesellschaft eher gering: Auf die Frage hin, wo in der Krankenversorgung am ehesten gespart werden könnte, wird Alkoholismus am häufigsten genannt. (Psychiatry Psychiatr Epidemiol.)
Auch auf struktureller Ebene werden Menschen mit Suchterkrankungen diskriminiert. Zum Beispiel müssen sie – im Gegensatz zu Menschen mit anderen psychischen Erkrankungen – nach zehn psychotherapeutischen Behandlungsstunden mittels ärztlicher Bescheinigung nachweisen, dass sie abstinent sind, um ihre Therapie weiterhin finanziert zu bekommen.
Stigmatisierung kann sich gegen die eigene Person richten und zu Scham, sinkendem Selbstwert und einer geringeren Wahrscheinlichkeit, sich Hilfe zu suchen, führen.
Außerdem könne es passieren, dass Suchtkranke die negativen Einstellungen der Umgebung annehmen, sich beispielsweise selbst als willensschwach bezeichnen, erklärt Speerforck – und sich die Stigmatisierung so gegen die eigene Person richtet. Das führe zu Scham, sinkendem Selbstwert und einer geringeren Wahrscheinlichkeit, Hilfe zu suchen. Auch damit lässt sich erklären, warum nur ein Bruchteil der Betroffenen in Behandlung ist und oft Jahre vergehen, bevor sie professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. (Fachverband Sucht ).
Lukas’* Leben hat sich früher um Pillen, Koks, Gras und Alkohol gedreht. Heute ist er 24 Jahre alt und seit eineinhalb Jahren abstinent. Er hat das Gefühl, dass Sucht oft nicht als Krankheit anerkannt wird. Vielen Menschen falle es schwer, zu verstehen, was eine Sucht ausmacht, glaubt Lukas. “In meinem Alter konsumieren viele etwas. Es ist schwer, anderen Leuten zu erklären, dass ich nicht ‘ein bisschen was trinken’ oder ‘mal an einem Joint ziehen’ kann. Ich bin nicht im Stande, in Maßen zu konsumieren.” Er sagt auch: “Ich würde mir mehr Verständnis dafür wünschen, dass Sucht keine freie Wahl ist.” Als er noch Drogen nahm, warfen ihm Freunde oder die Familie vor, ihm fehle die Disziplin oder der Wille. Wollte er es gar nicht anders? War ihm einfach alles egal?
“Verantwortung und Schuldzuschreibungen spielen beim Suchtstigma eine wichtige Rolle”, sagt Sven Speerforck. Die betroffene Person werde für die Sucht selbst verantwortlich gemacht. Bei einer Suchterkrankung kann man aber nur bis zu einem gewissen Punkt von Schuld- und Verantwortungsfähigkeit sprechen, sagt er. “Wenn jemand schwer intoxikiert ist, dann ist das ein Zustand, in dem jemand häufig schlechter Verantwortung für sich übernehmen kann. Da müsste zunächst eine soziale Verantwortung greifen, um die individuelle Verantwortung möglichst schnell wiederherzustellen”, sagt Speerforck.
“Stigmatisierung erschwert die Bewältigung der Sucht, anstatt den Betroffenen zu helfen”
Stigmatisierung ist der Versuch einer Gesellschaft, unerwünschtes Verhalten zu regulieren. Nach dem Motto: Wenn du dazugehören willst, musst du dich auf eine bestimmte Weise verhalten. Passt die betroffene Person ihr Verhalten nicht an, wendet sich das soziale Umfeld von ihr ab. Konstruktiv ist das nicht – im Gegenteil: “Stigmatisierung erschwert die Bewältigung der Sucht, anstatt den Betroffenen zu helfen”, sagt Sven Speerforck. Deshalb sei es wichtig, Suchtkranke über Stigmatisierung aufzuklären und sie und ihre Angehörigen dabei zu unterstützen, sich gegen Ausgrenzung und Diskriminierung zu wehren. Es sei wichtig den Betroffenen zu vermitteln: “Das, was ihnen passiert, ist ungerecht. Das hat einen Namen, das ist ein Stigma – das liegt nicht daran, dass sie ein schlechter Mensch sind”, sagt Speerforck.
“Ich würde mir wünschen, dass wenn jemand Hilfe sucht, der nicht als gescheitert gilt, sondern ganz im Gegenteil: Derjenige befindet sich auf dem Weg, sein Problem zu lösen.”
Lukas ist froh, heute ein freieres Leben führen zu können. Er spricht nur noch selten über seine Sucht, auch weil er das Gefühl hat, dass viele Menschen dieses Thema lieber meiden. Aber eine Botschaft ist ihm wichtig: Es gibt Lösungen – Betroffene und ihre Angehörigen müssen nicht leiden. Andreas sieht das ähnlich. Er sagt: “Ich würde mir wünschen, dass wenn jemand Hilfe sucht, der nicht als gescheitert gilt, sondern ganz im Gegenteil: Derjenige befindet sich auf dem Weg, sein Problem zu lösen. Das würde mir die Angst nehmen, dass mein Thema rauskommt. Und es würde auch dazu führen, dass Leute, die unter einer Suchtkrankheit leiden, sich trauen, damit rauszugehen.”
* Andreas und Lukas heißen eigentlich anders. Sie wollen nicht, dass ihre echten Namen in diesem Text veröffentlicht werden.
2 Comments
Comments are closed.
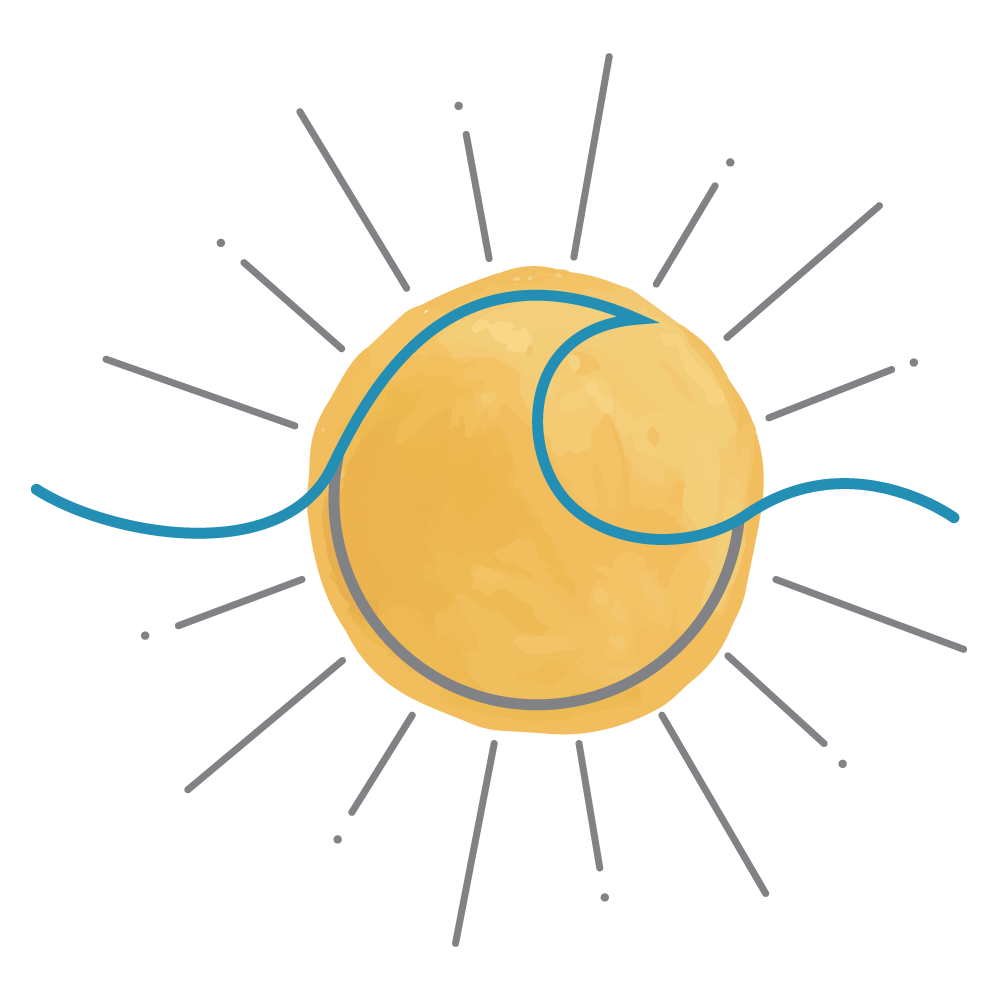
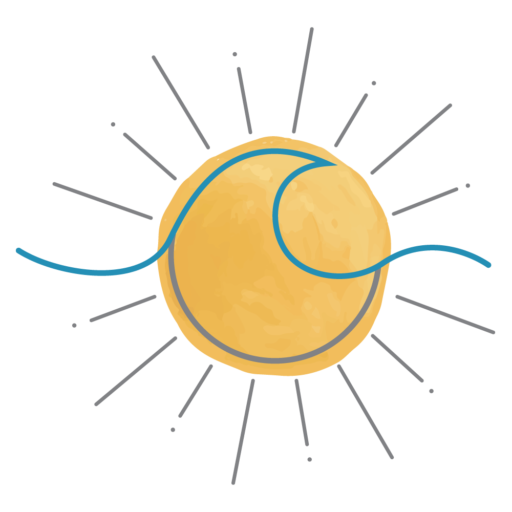






Pingback: Menschen mit psychischen Erkrankungen leiden doppelt - Hanna Winterfeld